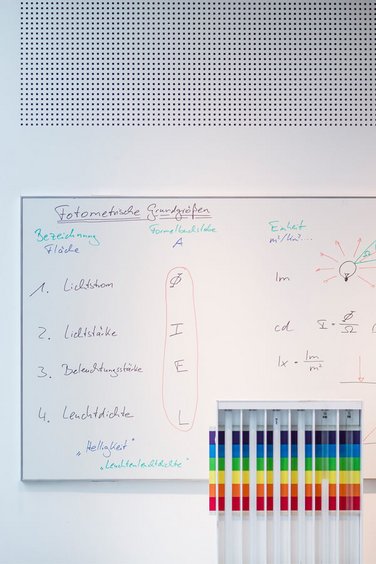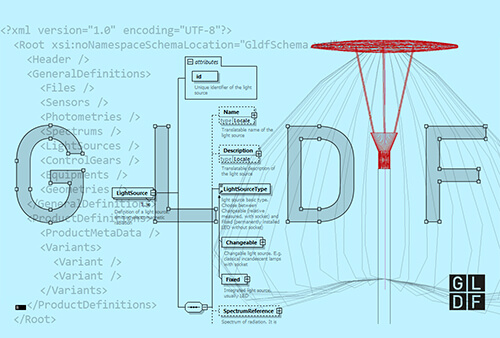| DSID | Google: Sicherheit, Funktionalität, Werbung für AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display + Video 360, Search Ads 360 | 2 Wochen | HTML | Google |
| test_cookie | Google: Funktionalität für AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display + Video 360, Search Ads 360 | 15 Minuten | HTML | Google |
| IDE | Google: Werbung for Campaign Manager, Display + Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360 | 24 Monate | HTML | Google |
| FPLC | Google: Analytik für Google Analytics | 20 Stunden | HTML | Google |
| FPID | Google: Analytik für Google Analytics | 2 Jahre | HTML | Google |
| GA_OPT_OUT | Google: Funktionalität für Google Analytics | 7 Jahre | HTML | Google |
| __utma | Google: Analytik für Google Analytics | 2 Jahre | HTML | Google |
| __utmb | Google: Analytik für Google Analytics | 30 Minuten | HTML | Google |
| __utmc | Google: Analytik für Google Analytics | Session | HTML | Google |
| __utmt | Google: Analytik für Google Analytics | 10 Minuten | HTML | Google |
| __utmz | Google: Analytik für Google Analytics | 6 Monate | HTML | Google |
| __utmv | Google: Analytik für Google Analytics | 2 Jahre | HTML | Google |
| _ga | Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. | 2 Jahre | HTML | Google |
| _gat | Wird zum Drosseln der Anfragerate verwendet. | 1 Minute | HTML | Google |
| _gat_--custom-name-- | Google: Analytik für Google Analytics | 1 Minute | HTML | Google |
| _gid | Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. | 24 Stunden | HTML | Google |
| _ga_--container-id-- | Speichert den aktuellen Sessionstatus. | 2 Jahre | HTML | Google |
| _dc_gtm_--property-id-- | Wird von DoubleClick (Google Tag Manager) verwendet, um die Besucher nach Alter, Geschlecht oder Interessen zu identifizieren. | 1 Minute | HTML | Google |
| _gaexp | Google: Analytik für Google Analytics, Optimize | 93 Tage | HTML | Google |
| _gaexp_rc | Google: Analytik für Google Analytics, Optimize | 10 Sekunden | HTML | Google |
| _opt_awcid | Google: Analytik für Google Analytics, Optimize | 24 Stunden | HTML | Google |
| _opt_awmid | Google: Analytik für Google Analytics, Optimize | 24 Stunden | HTML | Google |
| _opt_awgid | Google: Analytik für Google Analytics, Optimize | 24 Stunden | HTML | Google |
| _opt_awkid | Google: Analytik für Google Analytics, Optimize | 24 Stunden | HTML | Google |
| _opt_utmc | Google: Analytik für Google Analytics, Optimize | 24 Stunden | HTML | Google |
| _gac_--property-id-- | Enthält Informationen zu Kampagnen für den Benutzer. Wenn Sie Ihr Google Analytics- und Ihr Google Ads Konto verknüpft haben, werden Elemente zur Effizienzmessung dieses Cookie lesen, sofern Sie dies nicht deaktivieren. | 90 Tage | HTML | Google |
| AMP_TOKEN | Enthält ein Token, das verwendet werden kann, um eine Client-ID vom AMP-Client-ID-Service abzurufen. Andere mögliche Werte zeigen Opt-out, Anfrage im Gange oder einen Fehler beim Abrufen einer Client-ID vom AMP Client ID Service an. | 1 Jahr | HTML | Google |